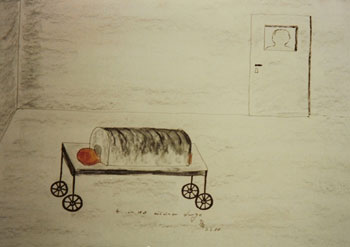Inseln · Mein Leben mit Gott
Vorwort · Seelsorge & Begegnung
Annegrete Fecklers Lebensweg ist ein Ringen mit Gott. Mit zwei Jahren an Kinderlähmung erkrankt und durch viele Krankenhausaufenthalte sozial isoliert, hatte sie in ihrem Leben oft nur Gott als einzigen Gegenüber. „Trotz häufiger Zweifel, mitunter Verzweiflung habe ich meine Geschichte mit Gott als heilsam erlebt.“ In schonungsloser Offenheit spricht Annegrete von ihrer Beziehung zu Gott, von Klage, von Bitte und Annahme und von Versöhnung. Die Texte und Gedichte werden auf einfühlsame Weise begleitet von der Musik Johanna Akomeahs. Mit Stimme, Klavier, Flöte und Akkordeon lässt sie ihre Resonanz erklingen – als Teppich, der die Worte trägt, als schützender Mantel, der sie umhüllt oder als Antwort auf Schreie und Hilferufe. Diese Zwiesprache von Wort und Musik berührt, lässt die Worte noch eindringlicher wirken und schenkt Trost, wenn großer Schmerz aus den Zeilen Annegretes spricht. Die Bilder, die Annegrete gemalt hat, öffnen einen weiteren Raum des Erlebens. Jeden Text setzt sie in Beziehung zu einem Bild. Diese Bilder haben noch einmal eine ganz eigene Kraft. Sie ziehen in Bann und erschüttern, wenn sich in ihnen die Aussagen über Einsamkeit, Verzweiflung, Hoffnung und Liebe spiegeln. Wer bereit ist, Annegretes Weg mitzugehen, Schmerz und Zweifel auszuhalten, wird bewegende, berührende, vielleicht auch befremdliche Momente erleben, und er wird beschenkt werden durch die kleinen, beständigen Schritte, die aus dem Dunkel schließlich herausführen – nicht in ein Leben ohne Krankheit und ohne Zweifel, aber in ein Leben mit tief empfundenen Momenten der Leichtigkeit, der Schönheit und des Friedens – mit Gott und mit sich selbst. Wir sind sehr froh, dass wir im Selbstverlag dieses Zeugnis eines persönlichen, heilsamen Glaubensweges als Buch und CD vorlegen können und wünschen eine tiefe Begegnung mit dem Gelesenen und Gehörten.
Für Seelsorge & Begegnung
Pfarrer Karl-Hermann Büsch
Regina Henke
Vorwort · Johanna Akomeah
„Hörst du die Schreie, die Schreie bei Tag und bei Nacht? Die Schreie, die sich an den Wänden deiner Heimat hoch fressen und jeglichen Winkel besetzen?“ Ja, ich hörte diese Schreie ganz tief in meiner Seele, ich spürte sie förmlich in mir hoch kriechen und wider- und widerhallen bis – wie durch ein Stimmengewirr hindurch dringend – diese Schreie zu schrillen dissonanten Akkorden wuchsen. Berührt von Annegrete Fecklers Leidensgeschichte rührten sich dumpfe, monotone, verhaltene Klänge in mir, im Gegensatz dazu bewegten mich auch verspielte, ja, fast romantische Melodien zu Texten wie „Suche mich“ oder „Liebesgeflüster“. Es war für mich keine mühevolle Arbeit, Annegrete Texte musikalisch zu interpretieren. Ihre fein gesponnene Prosa und Lyrik sowie ihre ausdrucksstarken Bilder machten es mir leicht, mich in ihr Schicksal einzuleben, und so flossen die Klänge fast mühelos aus meinen Fingern in die Tasten. Ich empfand mich dabei stets als Dienerin ihrer Worte und war aufs Äußerste bemüht, ihre sprachliche Aussage in eine authentische musikalische Form zu bringen. In diesem Zusammenhang standen auch meine Bemühungen, wechselnde Strukturen und Instrumentierungen oder den Einsatz vokaler Interpretation zu wählen. Diese sollten dem Inhalt nochmals eine neue Farbe, Klangfarbe, Sichtweise verleihen. Die gesanglichen Beiträge erheben keinen Anspruch auf Perfektion, sondern stellen wie alle anderen Beiträge den Versuch dar, die Texte von Annegrete durch ein anderes Fenster, durch das Medium der Musik transparenter zu machen. Die Arbeit mit Annegrete Feckler war von der ersten Stunde an ein harmonisches Miteinander und war trotz der Schwere des Inhalts eine erfreuliche, produktive Zusammenarbeit, die über die Begegnung mit Wort, Bild und Musik auch noch das Geschenk einer tiefen Begegnung mit Gott möglich machten. Die CD wurde im Tonstudio von Robert Juretzki in Köln-Bickendorf produziert. Kompetent, einfühlsam und ideenreich begleitete er unsere Arbeit. Dafür sei ihm ein herzliches „Danke schön“ gesagt.
Johanna Akomeah
Vorwort · Annegrete Feckler

Johanna Akomeah und Annegrete Feckler
Johanna Akomeah und Annegrete Feckler
Premiere im Paulushaus Mai 2006
Gott hat viele Wege und viele Gesichter – so viele, wie es Menschen gibt.
Und:
Gott hat kein Gesicht – er ist immer anders,
als ich erwarte oder befürchte.
Gott ist immer der, der er sein wird.
Wenn kein Mensch mehr für mich da ist, kein Gedanke mehr einen Weg ins Freie findet und meine eigenen Kräfte nicht mehr ausreichen – dann wird ER da sein.
Wenn nichts mehr geht, geht Gott!
Meine Texte werden wunderbar auf den Schwingungen der Musik von Johanna Akomeah getragen und ummalt, so wie alle Leidenden auf den Schwingen der Liebe Gottes getragen werden und in IHM geborgen sind.
Annegrete Feckler
Am Morgen danach

Anfang
Plötzlich war mein Leben zu Ende. Ich war aus meiner Verbundenheit herausgefallen. Die Sonne an meinem Himmel verlosch und übrig blieb das NICHTS. Niemand durfte mich besuchen. Ich war allein. Ab und zu erschien ein Gesicht an meinem Fenster. Anfangs konnte ich noch das Gesicht meiner Mutter erkennen, dann waren es nur noch fremde Gesichter. In meiner eisernen Lunge konnte ich mich nicht bewegen. Manchmal kam jemand, um mir eine Geschichte vorzulesen. Sonst geschah nichts. Die Tage blieben stumm und leer, wie ich, die man wie eine Puppe überall hintrug und die manchmal „Mama“ schrie, wenn man sie auf den Bauch drehte.
Krankenhaus
Mama redete mir zu. Redete von Vernunft, von gesund werden und verstehen müssen, ich sei doch schon groß – ich hörte nicht hin, ich kannte das schon. Am Fenster sehe ich die Gesichter meiner Geschwister, voller Erwartung. Ich will nicht bleiben, will auch nicht vernünftig sein. Mama sagt, dass sie ja wiederkäme, um mich heimzuholen, doch das weiß ich besser. Wenn ich ihr glaube, wenn ich sie loslasse, dann lässt sie mich allein, dann wird sie gehen und nie mehr wiederkommen! – am Fenster meine Geschwister, sie lachen und winken. Ich will nicht bleiben, will wieder heim! – Mama weint, Mama bittet, Mama fleht mich an, doch auch sie zu verstehen. Sie schaut mich so verzweifelt an, dass sie mir leid tut und ich schweige still –
Geliebtsein
Als ich endlich wieder aufstehen durfte und auch wieder gehen konnte,
nahm mich die Beschäftigungstherapeutin mit in ihr Heiligtum.
Ich wusste, es war eigentlich nicht erlaubt.
Es war ein katholisches Krankenhaus und
ich war evangelisch.
Dennoch nahm sie mich mit.
Sie ging voraus,
ich folgte ihr.
Sie schlug das Kreuz,
kniete vor dem Altar
und ich machte es ihr nach.
Da standen wir
Hand in Hand
in dieser Kirche –
unendlich hoch
und groß und weit.
In allen Winkeln funkelte es
hell und licht und bunt.
So groß der Raum
und doch nicht klein
fühlte ich mich –
groß, geliebt und
angenommen.
Da stand ich mit ihr,
die mich liebte
und ich fühlte mich geliebt
auch von einem Gott,
dessen Herz so groß
und hell und licht sein musste
wie dieses Haus,
in dem er wohnte.
Entlassung aus dem Krankenhaus
An einem Tag, es war der Geburtstag meiner Mutter, durfte ich wieder heim. Ich war sehr aufgeregt, denn ich hatte meine Mutter während des gesamten Krankenhausaufenthaltes nicht gesehen. Der Flur, den es zu bewältigen gab, war noch immer unendlich lang. Am Ende des Gangs stand sie, mit ausgebreiteten Armen – und ich laufe, das erste Mal in meinem Leben ganz alleine, renne ihr sogar entgegen, falle ihr in die Arme, sicher fängt sie mich auf – wir weinen, weinen beide vor übergroßer Freude – eng schlossen sich ihre Arme um mich – ach, Mama, ach, Mama, wir schlossen uns ein …
Nach Hause kommen
Blumen, ein Blumenmeer schwimmt in unserem Garten, in Rot und Blau und Gelb. Ich rieche das Leben – süßlicher Duft. Knie mitten im Blumenbeet, umarme die Blumen, staune, berühre das Blühen und fasse es nicht. Lang, viel zu lang war die Zeit im kranken Weiß der Betten und Wände. Doch Unverstand umzingelt mich. Dornenhecken wachsen und schneiden mir ins Fleisch. Verrückt soll ich sein, sagen die Geschwister. Niemand weiß und niemand fragt wie kalt und kahl und leichenblass im Krankenhaus es war.
Wieder im Krankenhaus
Eine Frau kommt herein. Sie hat nur ein Auge. Ihr Gesicht ist angespannt und der Blick abwesend. Sie schaut überall hin, nur nicht auf ihr Kind. Ihre Kleider sind schwarz. Das Kind streckt sich nach ihr aus, um sie freudig zu umarmen; sie wehrt ab, wie man eine lästige Fliege verscheucht. „Ich habe dir etwas mitgebracht“, sagt sie. „Das habe ich mir vom Mund abgespart“. Schweigen! „Ach, wie bin ich geplagt“, beginnt wieder die Frau. Eigentlich erwartet sie keine Antwort, sie sagt es einfach so in den Raum. „Dieser Mann, diese Kinder“, klagt sie. „Und weißt du, was das Schlimmste ist, ich bin auch noch mit einem kranken Kind gestraft.“ Dann steht sie auf und geht ohne Abschiedsgruß und ohne sich noch einmal umzudrehen. Nichts bewegt sich. Irgendwo draußen auf dem Gang klappert Geschirr. Ab und zu leises Kinderweinen, Wimmern und ein Rufen nach der Mutter. Die Frischoperierten, die schreien noch, rufen und weinen nach ihrer Mutter, die wissen noch nicht, dass sie nicht kommen wird. Sie nicht und auch sonst niemand … Draußen das Klappern, das Weinen und Rufen. „Wie soll ich leben, Gott? Hol mich doch hier raus!“ Plötzlich ist alles still. Kein Klappern mehr und kein Geschrei. Weit in der Ferne, schlag Mitternacht, beginnt irgendwo leise ein Trompetenspiel. „Das ist Gott! Jetzt spielt er mir ein Wiegenlied, damit ich endlich atmen und schlafen kann.“ (verkürzte Fassung)
Schreie
Hörst du die Schreie, die Schreie bei Tag und bei Nacht? Die Schreie, die sich an den Wänden deiner Heimat hoch fressen und jeglichen Winkel besetzen? Hörst du die Schreie, die sich wie Kletten an dich klammern, die nicht weichen wollen, sich immer tiefer in die Stille deiner Seele fressen? Hörst du die Schreie, die sich aus Rillen und Löchern pressen, dein Haus besetzen und dein Herz? Kennst du die Schreie, die dir das Sonnenlicht nehmen, dir deine Umwelt vernebeln, dich verfolgen bei Tag und bei Nacht?
Rettungsversuche
Mein Leben wurde immer unerträglicher. Ich rettete mich auf eine Insel. Alle Brücken brach ich hinter mir ab. Nichts sollte mich mehr mit dem Festland verbinden. Aber die Wellen der Katastrophen schlugen bis an die Ufer meiner Insel. Der ganze Unrat, wie nach Hochwassern so üblich, schwemmte auf meine Insel und überlastete mich. Dabei fühlte ich mich wie der schlechteste Mensch aller Zeiten, weil ich meiner Mutter nicht mein Leben opfern wollte, so, wie sie es für mich geopfert hatte. Ein Stachel, der sich immer tiefer in meine Seele bohrte. Ich war zu einem Menschen geworden, der immerzu nur weinte und täglich in den Wald lief, Gott auf Knien und unter Tränen anzuflehen, mich doch endlich aus dieser Welt zu erlösen. Aber Gott erlöste mich nicht, er antwortete mir auch nicht, so dass ich irgendwann glaubte, dass auch Gott dieses Opfer von mir wollte.
Das Ende
Mein Hunger nach Lieben und Geliebtsein war nicht mehr auszuhalten. Ich brach Schule und Praktikum ab und fuhr nach Hause. Aber alles war noch viel schlimmer, als ich es mir je hätte träumen lassen. Meine Mutter stieß mich nicht nur zurück, sie sprach auch monatelang kein Wort mehr mit mir. Sie wollte sich erst dann wieder meiner erbarmen, wenn ich reumütig auf Knien angekrochen käme, sie um Verzeihung zu bitten, weil ich es gewagt hatte, etwas gegen ihren Willen zu tun. Und es kam der Tag, da kam ich angekrochen, da ergab ich mich, gab ich mich auf, verkaufte ich meine Seele. Plötzlich gab es mich nicht mehr und was noch schlimmer war, an diesem Tag verlor ich auch meinen Gott. Ich war ein Nichts im Nichts. Eine Marionette, die nur noch tat, was man ihr auftrug. In meinen Gedanken war nur noch Irritation. Nichts, was ich dachte, machte noch Sinn. Ich hätte so sehr einen Menschen gebraucht, aber da war niemand.
Mein Leben ist zerbrochen
Mein Leben ist zerbrochen
Mein Leben ist zerbrochen;
auf meinen Wegen
liegt zersplittertes Glas.
Meine Sonne ist untergegangen
und niemand weiß
wo sie hingegangen ist.
Trauer liegt auf meinen Wunden
zu ersticken den Schrei,
den niemand zu hören vermag.
Meine Ohren sind taub
vom Gebrüll der nächtlichen Qual,
die widerhallt von den Wänden.
Meine Augen sind blind geblendet
von den vielen Hoffungslichtern,
die längst verloschen sind.
Heimatlos suche ich Heimat
und verliere doch schon
noch bevor, dass ich besaß.
Die Wurzeln meines Seins
finden keinen Boden zum Wachsen
und werden mir zu Schlingen und Fallen.
Wund sind meine Füße vom Suchen.
Wund ist mein Herz vom Hoffen.
Schmerzen und Tränen sind mein Brot.
Meine Sonne ist untergegangen
und niemand weiß,
wo sie hingegangen ist.
Der wichtigste Mensch in meinem Leben
Nachdem mich alle aufgegeben hatten und ich nicht mehr leben wollte, sah ich dich zum ersten Mal. Du warst Pfarrer und besuchtest jemanden im Krankenhaus, in dem auch ich war. Du kamst auf einem Motorrad und musstest im Vorraum deine Motorradhose ausziehen. Ich beobachtete dich von weitem, aus einem sichereren Versteck heraus, das ich mir beizeiten gesucht hatte, denn ich wusste, dass du kommst – man hatte mir viel von dir erzählt. Etwas später begegnete ich dir ein zweites Mal. Ich war Begleitperson für denjenigen, den du im Krankenhaus besuchtest. Diesmal wollte er dich besuchen. Ich blieb im Vorraum sitzen und wartete. Im Traum hätte ich nicht daran gedacht, dich anzusprechen und dich kennen zu lernen, obwohl ich darauf brannte. Dann standest du plötzlich vor mir und sprachst: „Ich habe gehört, dass du einen Vater suchst. Ich bin einer. Ich habe zwar schon vier Kinder, aber eines passt noch dazu“. An diesem Tag kehrte Gott zu mir zurück. Und doch sollte mein Leben noch nicht beginnen. Nach einem halben Jahr der Irrfahrten, erinnerte ich mich an dich. Du warst der einzige Mensch, von dem ich mich verabschieden wollte. Dieses Mal sollte man mich nicht zurückholen können. Da standest du in weit aufgerissener Tür mit weit ausgebreiteten Armen: Ich kam zum ersten Mal in meinem Leben irgendwo an. Dieses Mal wollte ich bleiben. Jetzt lernte ich dich kennen, mein Vater auf Zeit, geliehen nur und doch wurdest du der wichtigste Mensch in meinem Leben. Du hattest keine Angst vor mir – ich durfte dich sogar berühren und dich umarmen. Immer, wenn du mit deiner Familie in Urlaub fuhrst, war es mir, als würdest du mir sterben. Wenn du dann wiederkamst, brauchte es lange, bis ich dich erkannte und du mir wieder vertraut warst. Bis ich eines Tages ein Grübchen in deinem Gesicht entdeckte, gleich neben der Nase. Wenn ich meine Lippen in dieses Grübchen drückte, konnte ich dich wieder spüren, dich wahrnehmen, warst du mir Vater und Mutter zugleich. Wie oft gabst du mir bei dir einen Platz zum Schlafen, wachtest über mir, wenn die Übelkeit mich übermannte. Wie oft weinte ich deine Hosen nass – mein Gesicht in deinen Schoß gedrückt – und hinterließ große Flecken. Aber du warst auch der, der stark genug war, mir Grenzen zu setzen. Du ließest nicht alles mit dir machen, konntest bisweilen auch störrisch sein wie ein Esel. Es dauerte lange, bis ich mit dir wieder versöhnt war. Wie es zwischen Vätern und Töchtern so ist, war ich natürlich Hals über Kopf in dich verliebt. Jedoch, was das Kind in mir durfte, als erwachsener Mensch war es mir nicht erlaubt und so habe ich auch viel an dir gelitten. Das vielleicht Schönste mit dir war, als ich mich abends wie ein kleines Kind auf deinen Schoß setzen durfte und du mit mir gebetet hast. Ich danke dir, dass es durch dich möglich war, ein Stück Kindheit und Vertrauen nachzuholen, um so auch in meiner Seele erwachsen zu werden.
Jörg
Dein Atem in meinem Ohr
deine Wärme in meinem Gesicht
geben mir Mut
in meine Nacht hineinzulauschen.
Du kommst zu mir
berührst meine Hand –
leises fernes Glockengeläut.
Ich taste nach dir
spiele mit deinen Fingernägeln
und der weiße Frost taut von den Dächern.
Aufgestanden
Aufgestanden
Schwarz
wie der Baum
vor meinem Fenster
vom Wind gebogen.
Aufgestanden
als Schwarz im Grau
wegen eines Lichts.
Kaum höre ich es atmen
kaum spüre ich
seinen Hauch.
Doch leise
bewegt sich ein Blatt
im Wind
steigender Wärme.
Wird mir auch heute
noch nicht warm
wird es auch heute
noch nicht Tag
so bin ich doch
aufgestanden
einen Schritt weiter
auf meinem Weg.
suche mich
suche mich
ach, finde mich
Du Sonnenlicht
und wärme mich
liebe mich
ach, segne mich
Du Sonnenglanz
und leite mich
sei Sonne
Mond und Sterne
ach, wie gerne
sähe, hörte, fühlt ich Dich
so sehr mein Herz
verzagt, verzaust
zerrissen gar
ich find Dich nicht
ach, Du, mein Gott
sei Du mir nah
berühre mich
sonst sterbe ich
stell kein Zahlenrätsel mir
noch Barrikaden
komm einfach schnell
weil ich Dich ruf
Dein Kind in Not
nicht laut
ganz still
versinke ich im Meere
komm, Du,
ach, komm
zu mir geschwind
und weide meine Seele
Zu Gast bei Dir
Ich weiß, dein Haus war immer offen. Ich habe mich nur zu
sehr geschämt, mit meinen schmutzigen Kleidern auf
deinem Fest zu erscheinen.
Gerne hätte ich meinen Rucksack vor deiner Tür abgeladen
– aber ich werde ihn nicht los. So stehe ich nun beladen und
schmutzig mitten in deinem Wohnzimmer.
Ich fasse es nicht – Du legst deinen Arm um mich und sagst:
„Komm!“ Siehst du denn die dicken Schlammschlieren an
meinen wunden Füßen nicht? Ich werde deinen Teppich
ruinieren! Siehst du denn nicht, wie alles an mit trieft und
tropft, wie unaufhörlich meine Tränen fließen?
Was sollen denn die Leute von dir denken, wenn du so
jemanden wie mich an deinem Tisch sitzen lässt?
Wenigstens die Hände hätte ich mir waschen sollen.
Siehst du nicht, wie alle mit dem Finger auf mich zeigen und
rufen: „Die da, aber die doch nicht!“
Ist es wahr, hast du es tatsächlich gerade gesagt:
„Die da, die gehört zu mir!“
Ich bin wie eine Wicke,
deren Stängel viel zu lang und viel zu schwach ist, sich selbst zu tragen. Bei jeder Bewegung suche ich zitternd einen Halt, an dem ich mich festhalten und weiter wachsen kann. Und dabei wollte ich wie ein Baum werden, der mit seinen Wurzeln tief in die Erde hineinwächst und im Erdreich fest verankert ist.
Schmerzen
Meine körperliche Kraft ist
sehr klein, zu klein und
meine Schmerzen sind
groß, zu groß. Manchmal
raste ich aus und schlage
um mich, weil ich die
Spannung nicht mehr
aushalte. Ich bin dann wie
ein wildes Tier.
Herr, erlaube mir, mich für
eine Weile zu deinen
Füßen zu setzen. Lege
deine Hand auf mein
Haar und segne mich,
denn ich bin müde, so
schrecklich müde, wie
nach tausend durchwachten,
sibirischen
Nächten.
Schattengesänge
in ihrer Länge
kommen gezogen
mich aus zusogen
An meinen Wänden
mit gefalteten Händen
entlang
länger
als mein Arm
abgerutscht
an klitschigen
Wänden
keuchender
weinender
schreiender
Seele
in einem dumpfen
Knall
Schall
sprenge
Funken sprühe
DU
überwinde für mich
das Minenfeld
aus Angst
und Wut
und Scham
dass ich mich
in Deine Arme
rette
statt in die Nacht
jenseits
der Schatten-
Gesänge
Du, halte mich,
wenn ich mich nicht mehr an DIR halte
folge mir,
auch wenn ich nicht mehr bei DIR bin
hole mich ein,
wenn ich DIR entschwinde
liebe mich noch,
wenn ich von DIR nichts mehr weiß
rufe mich,
auch dann, wenn meine Ohren längst taub
finde mich,
gerade dann, wenn meine Augen blind
umarme mich,
noch jenseits aller Zeiten
lass DEIN Werben
noch in Ewigkeit gelten
ich verlasse mich auf DICH:
bitte niemals lasse, verlasse mich nicht!
Amen
In die Grube gefallen
von außen gesehen
laufe ich über bunte Sommerwiesen
genieße ich den warmen Tag
singe ich bisweilen wie ein Vogel so klar
blühe ich wie die Blumen so bunt
doch in mir
betet es, wie Jonas in seinem Fisch
weint es, wie Jakob in seiner Grube
schreit es, wie Jeremia in seinem Loch
fragt es, wie Hiob in seiner Asche
manchmal
bricht meine Welt entzwei
falle ich ins Bodenlose
verlässt mich jeder Halt
sinke ich in den Abgrund
dorthin
wo die vom Aussatz befallenen
wo die von Allem verlassenen
wo die von Niemand verstandenen
wo die ohne Hoffnung auf Licht
aber DU
rollst ihn fort, den Stein
stellst mir eine Leiter hin
kommst zu mir in die Finsternis
bist mir Weg, Wahrheit und Leben
Sprich nur ein Wort
Sprich nur ein Wort
Nicht alle,
nicht die vielen,
nur ein Wort,
das eine Wort
das Wort,
das mich erreicht,
das mir hilft,
das mich verändert.
Das Wort,
das wie Samen
in mich hineinfällt
und Frucht bringt.
Nicht unter die Dornen,
damit es nicht erstickt,
nicht auf Felsen,
wo es verdorrt.
Sprich das Wort,
das Ketten sprengt,
das Fesseln löst,
und Türen öffnet,
das Wort,
das Felsen zerschlägt
und Wasser hervorbringt
in Wüsten.
Sag zu meiner Seele:
„Ich bin Dein Gott!“
Rede so,
dass ich Dich verstehen kann,
dass ich Dir folgen kann,
dass in mir
Dein Wort lebendig wird
und zu fließen beginnt.
Frieden
Frieden
In DEINEM Frieden
lebe ich
atme ich
bin ich geborgen
In DEINEM Frieden
spüre ich
erfahre ich
DEINE Nähe –
Berühre mich!
In DEINEM Frieden
getauft
und gesegnet –
DU Liebender –
angenommen bin ich
von DIR.
DEIN Friede nährt mich
und zählt mich
und fördert mich –
wachsen darf ich in DIR.
Schenke
und bewahre mir
Herr
DEINEN
Frieden.
Liebesgeflüster
dass ich dich nur nie vergesse
du Duft mal schwer mal leicht
auf sonnensteigenden Wiesengründen
dass ich dich nur immer mög’ vermissen
du Rauschen von Luft und Wälder
im kühlenden singenden Liebesgeflüster
dass ich dich nur immer werde hören
du Summen und Zwitschern
und Züngeln von Wärmegeflimmer
ich höre dich plätschern
kristallklares Blaufunken erfrischendes Nass
lustiger Bäche
ich kann dich atmen
sauerstoffspendender grünruhender Wald
Boden so sanft schwebend in dir
ich laufe dir entgegen du Blühen und Leben
mit ausgebreiteten Armen empfange ich dich
hoch auf den Bergen majestätisch ergriffen
lässt du mich blicken so schön so leicht und so weit
dein Reich im wolkenverhüllten Sonntagskleid
im Ahnen und Schauen ist kein Weg mir zu weit
trotz Quadratmeterenge
zusammengeschrumpftes Sein
aus Krankheit und Not
wächst jede Blume auf meinem Balkon
zum Danken und Loben
unzählige Male flüstert’s mir zu
du Schöpfer du All-Vater Mutter-Gott
Du